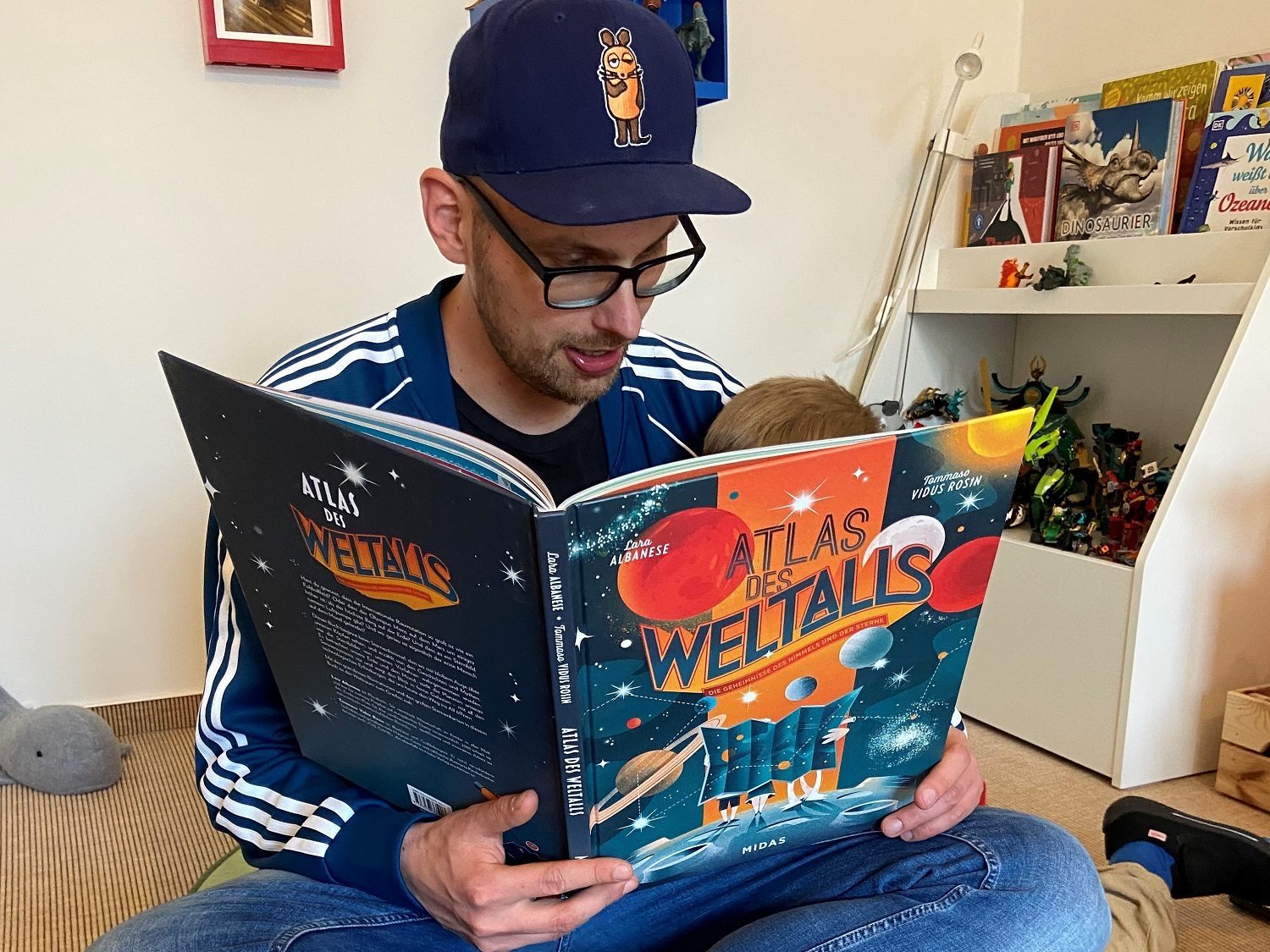Die Elternschaft im 21. Jahrhundert ist komplex, besonders wenn es um die Erziehung von Jungen geht. Obwohl sich die Gesellschaft in Richtung emotionaler Offenheit und Gleichberechtigung bewegt, herrschen in vielen Köpfen – und damit auch in den Kinderzimmern – noch immer starre Rollenbilder vor. Jungen sollen funktionieren, stark sein, hart sein. Auf keinen Fall weinen. Schon in den ersten Lebensjahren, in der Kita und später in der Grundschule, wird subtil und offen gelernt: Traurigkeit ist Schwäche, Zärtlichkeit peinlich, und Bedürftigkeit gilt als gefährlich.
Als Expertin für pädagogisch-psychologisches Mentoring und Gründerin der Praxis Floris beobachtet Jennifer Floris die erschreckenden Folgen dieser emotionalen Verarmung täglich. Elfjährige, die mit Panikattacken kämpfen. Zehnjährige, die einen tiefen Selbsthass entwickeln. Achtjährige, die lieber zuschlagen als ihre Gefühle in Worte zu fassen. Dies ist keine Erziehung zur Stärke. Es ist die Übertragung einer toxischen Männlichkeit, die männliche Kinder seelisch krank macht. Es ist zwingend notwendig, mit der Mär vom unerschütterlichen, coolen Jungen aufzuräumen und einen neuen Blick auf die emotionalen Bedürfnisse der Söhne zu wagen.
Die Mechanismen der emotionalen Verarmung
Toxische Männlichkeit beginnt nicht erst im Erwachsenenalter, sie wird früh durch subtile Mechanismen vermittelt. Oftmals geschieht dies unbewusst durch wohlmeinende, aber schädliche Botschaften:
Der Weinen-Stopp: Phrasen wie „Hör auf zu heulen“, „Sei kein Mädchen“ oder „Das ist doch nichts, worüber man weinen muss“ sind gängige Muster. Sie vermitteln die Kernbotschaft, dass bestimmte Emotionen – allen voran Trauer, Angst und Schmerz – nicht akzeptabel sind. Jungen lernen, diese Gefühle aktiv zu unterdrücken oder in andere Reaktionen umzuwandeln.
Der Zärtlichkeits-Tadel: Körperliche Nähe, Kuscheln oder sanfte Spiele werden ab einem bestimmten Alter oft als peinlich oder „unmännlich“ stigmatisiert. Freundschaften müssen in Wettkampf und rauerem Ton stattfinden, um als akzeptabel zu gelten.
Die Funktionalitätsfalle: Der Wert eines Jungen wird oft an seiner Leistung und seiner Fähigkeit, Probleme zu lösen, gemessen. Fühlen, Zuhören oder um Hilfe bitten fallen aus dieser Definition heraus. Das Kind wird auf seine Funktion reduziert: auf den erfolgreichen Schüler, den starken Sportler, den unkomplizierten Sohn.
Diese Botschaften wirken wie emotionale Korsetts. Sie zwingen Jungen in eine Verhaltensnorm, die zutiefst unnatürlich und schädlich ist. Die unterdrückten Gefühle verschwinden nicht, sie suchen sich andere, oft destruktive Ventile: Wut, Aggression, Rückzug oder die Entwicklung psychosomatischer Beschwerden.

Die fatalen Folgen für die kindliche Psyche
Die Folgen dieser emotionalen Blockade sind in der pädagogisch-psychologischen Beratung evident. Wenn Jungen keine gesunden Ventile für Angst und Trauer entwickeln dürfen, wird die innere Anspannung unerträglich.
Verhaltensstörungen als Ausdruck von Not: Die Aggressivität, die in vielen Schulhöfen und Familien beobachtet wird, ist häufig nicht primär das Resultat von schlechtem Benehmen. Sie ist oft eine überschießende Reaktion auf innere Hilflosigkeit. Wenn ein Junge nicht verbalisieren kann, dass er Angst hat oder sich verletzt fühlt, wird dies schnell durch einen Tritt, einen Schlag oder einen lauten Wutausbruch kompensiert. Die Aggression wird zum einzigen erlaubten Gefühl.
Innere Störungen: Die erlernten Mechanismen der Selbstunterdrückung manifestieren sich im Jugendalter oft in inneren Konflikten. Studien zeigen, dass Jungen Depressionen anders erleben als Mädchen. Sie zeigen seltener die klassische Traurigkeit, sondern reagieren mit Reizbarkeit, Risikoverhalten und Rückzug. Panikattacken und Selbstzweifel sind direkte Resultate dieser tiefen inneren Spaltung.
Mangelnde Beziehungsfähigkeit: Wer als Kind lernt, Emotionen zu verstecken, hat später Schwierigkeiten, echte Intimität aufzubauen. Die Fähigkeit zur Empathie und zur tiefen emotionalen Verbindung wird gehemmt, was sich negativ auf Partnerschaften und freundschaftliche Beziehungen auswirkt.
Begleitung mit Haltung, Herz und radikaler Erlaubnis
Die gute Nachricht ist: Eltern, Lehrkräfte und Betreuungspersonen können diesen Kreislauf durchbrechen. Es geht nicht darum, Jungen weich zu erziehen. Es geht darum, sie ganzheitlich zu erziehen, ihnen die radikale Erlaubnis zu geben, Mensch zu sein.
Emotionale Sprache lehren und vorleben: Erwachsene müssen die Tür zur emotionalen Welt öffnen. Das bedeutet, aktiv die Emotionen des Kindes zu benennen, ohne sie zu bewerten: „Das Kind ist gerade sehr wütend, weil das Bauwerk eingestürzt ist“ oder „Es scheint traurig zu sein, weil der Freund gegangen ist.“ Wichtig ist auch, die eigenen Gefühle authentisch, aber altersgerecht mitzuteilen.
Körperkontakt und Zärtlichkeit pflegen: Körperliche Nähe muss auch über das Kleinkindalter hinaus erlaubt und gefördert werden. Kuscheln, Umarmen oder einfach nebeneinander sitzen vermitteln Sicherheit und stärken die Bindung. Diese Zärtlichkeit ist essenziell für die neurologische und emotionale Entwicklung.

Rollenbilder erweitern: Es sollte darauf geachtet werden, welche Vorbilder männliche Kinder im Alltag sehen. Werden Männer nur als die Starken, die Ernährer oder die Kämpfer dargestellt? Es ist wichtig, auch Männer zu zeigen, die kochen, pflegen, weinen, sich kümmern und über ihre Gefühle sprechen. Die Diversität männlicher Lebensentwürfe muss sichtbar werden.
Aggression umlenken, nicht unterdrücken: Aggression ist Energie. Statt sie zu bestrafen, sollte man lernen, sie umzuleiten. Sport, kreative Ausdrucksformen wie Kunsttherapie oder Musik, aber auch das Erlernen von Deeskalationsstrategien können helfen. Es geht nicht darum, Wut zu verbieten, sondern darum, gesunde Wege für ihren Ausdruck zu finden.
Die Begleitung männlicher Kinder erfordert Mut und Haltung. Mut, gegen gesellschaftliche Klischees anzugehen, und Haltung, die eigenen Söhne in ihrer vollen emotionalen Bandbreite anzunehmen. Es ist an der Zeit, Jungen nicht nur beizubringen, wie man Probleme löst, sondern vor allem, wie man fühlt, wie man um Hilfe bittet und wie man tief in sich ruht. Das ist wahre Stärke.
Über die Praxis Floris
Die Praxis Floris bietet deutschlandweit Seminare und Schulungen für Fachkräfte und Quereinsteiger, während das Institut durch digitale Innovationen, wie die kommende App und den Podcast „Brückenbauer“, neue Maßstäbe setzt. Ihr Fokus liegt auf praktischen, inklusiven Lösungen und der Förderung eines bewussten Umgangs mit Kindern und Jugendlichen.
Website: https://www.praxis-floris.de & https://www.floris-institut.de