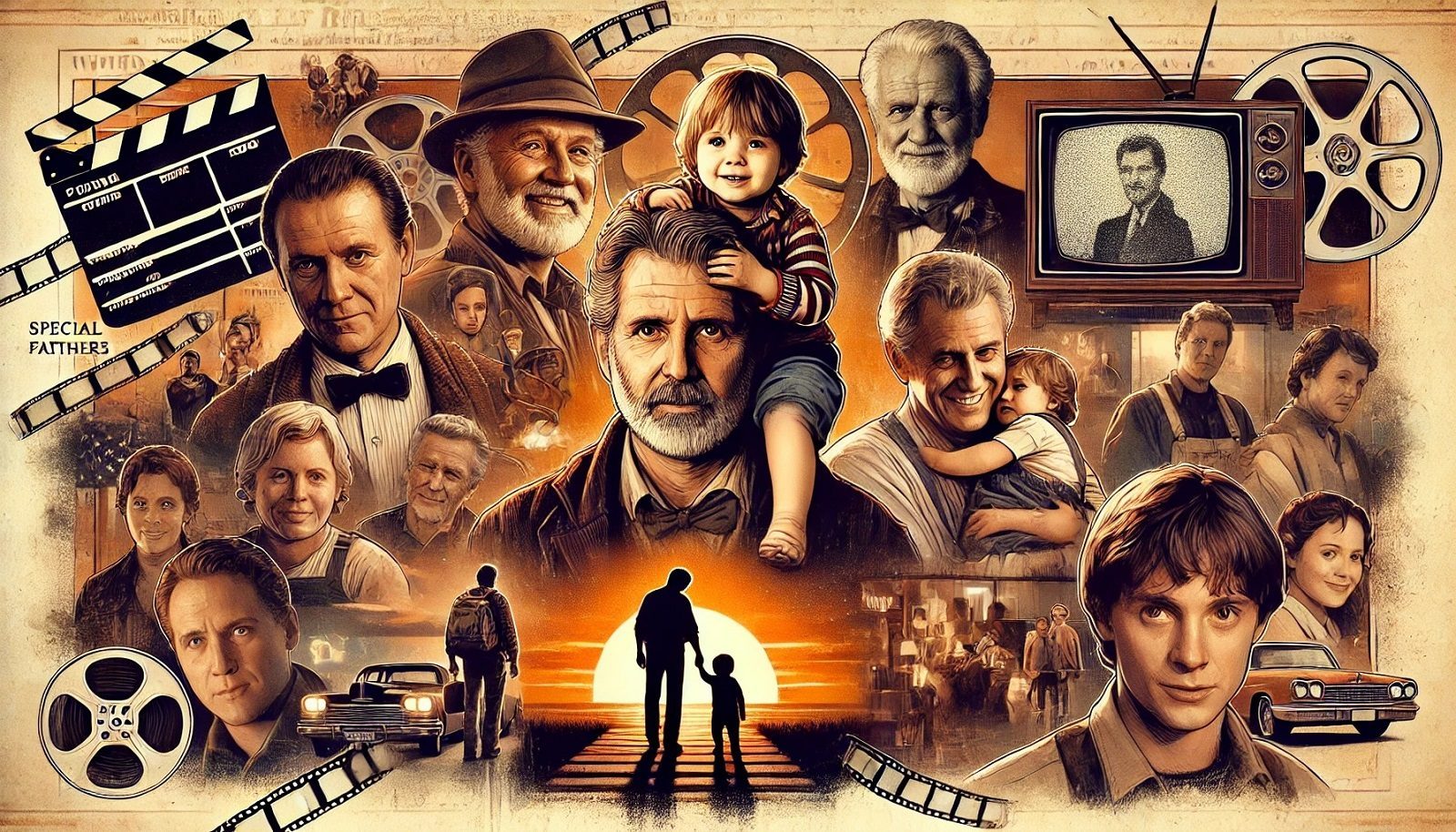Der Alltag von Familien ist bunt, turbulent und gerade in den ersten Lebensjahren der Kinder auch voller Erwartungen. Väter wollen moderne Papas sein, die Windeln wechseln, nachts aufstehen und Zeit mit dem Nachwuchs verbringen. Mütter hingegen stemmen traditionell immer noch den Großteil der Care-Arbeit und stellen dabei oft höhere Ansprüche an sich selbst, als die Väter es jemals von ihnen erwarten würden.
Das zeigt die aktuelle Studie „Familie und Erziehung 2025“ der Pronova BKK, für die 2.000 Mütter und Väter befragt wurden. Und sie legt offen: Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klaffen immer noch große Lücken.
Das Idealbild des Vaters – präsent, nahbar, engagiert
Was macht einen „guten Vater“ aus? Laut der Befragung wünschen sich 55 Prozent der Männer, viel Zeit mit den Kindern zu verbringen. Für 51 Prozent gehört es zum Ideal, „Freund und Beschützer“ zu sein. Rund die Hälfte verbindet das Vatersein auch mit der Übernahme von Haushaltsaufgaben, Mitspracherecht bei Erziehungsfragen und natürlich damit, für den Lebensunterhalt zu sorgen.
Das klingt modern und engagiert. Aber: In der Realität sieht es anders aus. Nur 46 Prozent der Väter geben an, tatsächlich viel Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Auch beim Windeln wechseln und nachts aufstehen klafft eine Lücke: 42 Prozent nennen es als Ideal, aber nur 36 Prozent setzen es wirklich um.

Das Problem: Viele Väter orientieren sich am Bild des „neuen Vaters“, der alles kann, doch Job, Tradition und fehlende Routine im Alltag bremsen sie aus. Mehr als die Hälfte der Männer arbeitet weiterhin Vollzeit, obwohl nur 36 Prozent das mit ihrem Wunschbild vereinbaren.
Mütter verlangen mehr – vor allem von sich selbst
Während Väter mit ihrem Spagat zwischen Ideal und Realität hadern, setzen Mütter die Messlatte noch höher. Sie wollen mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen (70 Prozent), zuhause bleiben, wenn das Kind krank ist (68 Prozent), und eine besonders enge emotionale Bindung pflegen. Das Interessante: Sie verlangen dies oft von sich selbst und nicht, weil die Väter es erwarten. Nur 58 Prozent der Männer wünschen sich etwa, dass die Partnerin viel Zeit mit dem Kind verbringt.
Das bedeutet: Mütter arbeiten am Limit, weil sie das Gefühl haben, immer noch mehr geben zu müssen.
Familienpsychologin Nina Grimm erklärt:
„Die Erwartungen der Mütter an die Beziehung zu ihrem Kind sind nur sehr bedingt davon geprägt, was Väter erwarten. Vielmehr spiegeln sie überhöhte bis verzerrte Ansprüche wider, die Mütter an sich selbst stellen.“
Hier zeigt sich ein gesellschaftliches Problem: Frauen sind geprägt durch Erfahrungen, Rollenbilder und biografische Prägungen und diese bremsen sie aus, selbst wenn sie mehr Entlastung suchen.
Unsichtbare Arbeit: Väter unterschätzen Care-Aufgaben
Ein zentrales Ergebnis der Studie: Väter nehmen die Leistungen der Mütter oft gar nicht wahr. Nur gut die Hälfte erkennt, dass ihre Partnerin den Haushalt organisiert. Und das, obwohl zwei Drittel der Frauen sagen, dass sie das tatsächlich tun. Auch beim „Kind krank“-Szenario gibt es eine Lücke: 67 Prozent der Mütter bleiben zuhause, aber nur 51 Prozent der Väter nehmen das so wahr.

Das zeigt: Viele Männer sehen die sichtbaren Aufgaben (Windeln, Essen kochen, Arzttermine), aber nicht die unsichtbare mentale Last. Wer organisiert die nächste Klassenfahrt? Wer denkt daran, dass der Turnbeutel gewaschen werden muss? Wer koordiniert Arzttermine oder Geburtstagsgeschenke? Das ist unsichtbare Arbeit und genau hier fehlt oft die Anerkennung.
Grimm bringt es auf den Punkt:
„Viele Väter wissen nicht, was es bedeutet, 24/7 präsent zu sein und einen Familienalltag zu managen. Genau diese emotionale und mentale Arbeit ist unsichtbar.“
Szenario aus dem Alltag: Kind krank – wer bleibt zuhause?
Ein Kind wacht morgens fiebrig auf. Die Kita ruft an: Abholen! Und dann? In der Realität bleiben meist die Mütter zuhause. Auch dann, wenn beide Eltern berufstätig sind. Die Studie zeigt, dass zwei Drittel der Frauen selbstverständlich in diesem Moment einspringen. Für viele Väter bleibt die Care-Arbeit in solchen Situationen unsichtbar. Sie merken nicht, dass ihre Partnerin an diesem Tag nicht nur auf das kranke Kind aufpasst, sondern nebenbei Essen kocht, Medikamente besorgt, Mails beantwortet, das Geschwisterkind entertaint und vielleicht sogar versucht, die eigenen Jobpflichten zu jonglieren.
Warum Väter mehr gefragt sind
Die Studie zeigt deutlich: Väter wollen mehr, aber sie müssen es auch umsetzen. Emotionale Nähe, Alltagspräsenz und Care-Arbeit dürfen nicht im Wunschdenken steckenbleiben. Und es reicht nicht, sich auf das Argument „Ich arbeite Vollzeit“ zurückzuziehen. Moderne Familien brauchen Väter, die Verantwortung im Kleinen wie im Großen übernehmen.
Nina Grimm fordert deshalb auch die Männer auf:
„Anerkennt die Tatsache, dass eure Partnerin mitunter geübter ist und Dinge berücksichtigt, die euch gar nicht bewusst sind. Nehmt das weder als persönlichen Angriff noch als implizite Information, dass sie euch nichts zutraut.“
Anders gesagt: Männer dürfen lernen, dass es nicht darum geht, es „perfekt“ zu machen. Sondern darum, es gemeinsam zu machen.
Zwischen Anspruch und Realität: Wo wir stehen
Die Pronova-BKK-Studie offenbart eine Schieflage:
- Väter haben gute Vorsätze, scheitern aber oft an Strukturen.
- Mütter haben zu hohe Ansprüche an sich selbst und brechen darunter fast zusammen.
- Väter erkennen die Arbeit der Mütter zu selten an.
Die Folge: Frust, Überlastung und Konflikte. Und genau hier braucht es Veränderung.

Gleichberechtigung fängt im Kopf an
Es ist leicht, den Finger auf Strukturen, Arbeitgeber oder Gesellschaft zu richten. Aber Gleichberechtigung fängt im Kopf an. Männer müssen die Care-Arbeit sehen, anerkennen und übernehmen. Frauen müssen lernen, Verantwortung abzugeben und auch mal „Fünfe gerade sein zu lassen“.
Grimm rät:
„Mütter sollten sich klarmachen, dass der Partner vieles anders machen wird – aber nicht automatisch schlechter.“
Und genau das ist der Schlüssel: Unterschiedlich ist nicht schlechter. Familien funktionieren, wenn beide Eltern Verantwortung übernehmen und wenn Vertrauen da ist, dass die Dinge auch anders gut laufen können.
Call-to-Action: Was Väter jetzt tun können
Liebe Väter, es reicht nicht, gute Vorsätze zu haben. Ihr müsst ins Handeln kommen.
- Macht Care-Arbeit sichtbar: Schaut hin, was eure Partnerin alles leistet, auch das Unsichtbare.
- Übernehmt aktiv Verantwortung: Nicht nur fragen, „Wie kann ich helfen?“, sondern einfach machen.
- Redet miteinander: Offene Gespräche ohne Rechtfertigungen schaffen Verständnis.
- Akzeptiert Unterschiede: Ihr macht Dinge anders und das ist okay. Wichtig ist, dass ihr es tut.
Denn am Ende zählt nicht das Idealbild, sondern der gemeinsame Alltag. Und der wird leichter, wenn beide anpacken.
Fazit
Die Studie zeigt: Zwischen Wunsch und Wirklichkeit liegen Welten. Väter wollen moderne Papas sein, Mütter sind zu streng mit sich selbst, und beide Seiten müssen lernen, Verantwortung neu zu verteilen. Gleichberechtigung im Familienalltag ist kein Nice-to-have, sondern die Grundlage für gesunde Partnerschaften und glückliche Kinder.
Es ist an der Zeit, dass Väter nicht nur darüber reden, was sie wollen, sondern es auch leben.